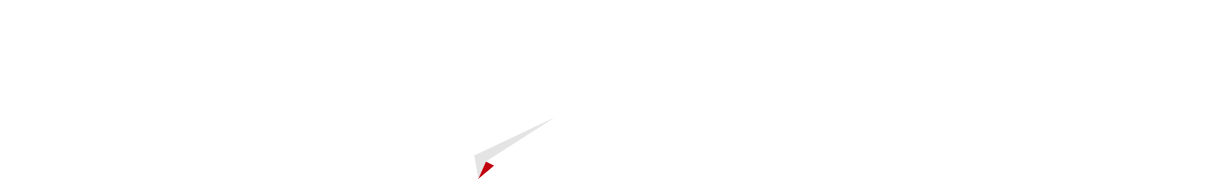Viele Unternehmen möchten gerne zu einer saubereren Umwelt beitragen und ihre eigenen CO2-Emissionen reduzieren – zum Beispiel indem sie ihre Fahrzeugflotte Schritt für Schritt auf Elektroantrieb umstellen. Dabei lassen staatliche Förderungen, Klimaziele und potenziell sinkende Betriebskosten die E-Mobilität zunehmend attraktiv erscheinen. Im Jahr 2023 waren 16,3 Prozent der neu zugelassenen Firmenfahrzeuge rein elektrisch angetrieben, und der Anteil bei den Neuzulassungen stieg allein im ersten Quartal 2025 um 68 Prozent. Immer mehr große Firmenflotten, wie zum Beispiel von SAP, BASF oder Boehringer setzen auf Elektromobilität. Auch wenn der Anteil der E-Fahrzeuge insgesamt noch gering ist, gehen Zuwachsraten also deutlich nach oben.
Die Frage, ob die eigene Fahrzeugflotte aktuell auch für kleine und mittlere Unternehmen wirtschaftlich auf Elektroantrieb umgestellt werden kann, lässt sich allerdings nur im Einzelfall, bzw. für einzelne Branchen und Nutzungsprofile, beantworten. Wir werfen einen Blick auf Chancen, Risiken und notwendige Voraussetzungen.
Entscheidend sind die Gesamtkosten
Gegen die Anschaffung von E-Fahrzeugen werden häufig die höheren Anschaffungskosten ins Feld geführt. Und, obwohl die Preisdifferenz zwischen Elektrischen und Verbrennern in den letzten Jahren deutlich gesunken ist und die Preisparität immer näher rückt, gibt es hier immer noch Unterschiede. Aktuelle Preisvergleiche zeigen, dass für ein E-Auto bei PKWs immer noch zwischen 3.000 und 8.000 Euro mehr zu investieren sind. Bei Transporter und Vans liegt die Preisdifferenz sogar bei 8.000 bis 12.000 Euro. Leider ist auch Leasing bei E-Autos aufgrund des höheren Listenpreises oft teurer. Es ist allerdings ein Fehler, nur auf den Anschaffungspreis zu starren. Entscheidend sind letztlich die Kosten über die gesamte Nutzungsdauer des Fahrzeugs, die „Total Cost of Ownership“ (TCO).
„Die Anschaffungskosten sind nur ein Teil der Wahrheit – wer die Wirtschaftlichkeit eines Fahrzeugs ganzheitlich betrachtet, erkennt: E-Mobilität ist nicht nur ein ökologischer Fortschritt, sondern zunehmend auch eine ökonomisch sinnvolle Entscheidung. Langfristig zählt, was ein Fahrzeug über seine gesamte Lebensdauer kostet – und da fahren elektrische Modelle zunehmend voraus“, erklärt Dr. Matthias Dürr, Projektleiter von ElektroMobilität NRW, der Dachmarke des nordrhein-westfälischen Wirtschaftsministeriums, unter der sämtliche Aktivitäten des Landes im Bereich Elektromobilität gebündelt werden.
Hier helfen Land und Bund
Ein Wermutstropfen vorab: Umweltbonus und Innovationsprämien der Bundesregierung von bis zu 6.750 Euro pro E-Auto sind Ende 2023 ausgelaufen, und es ist noch nicht absehbar, ob und ab wann neue Förderungen greifen werden. Man sollte sich allerdings über lokale und regionale Förderungen informieren. Aktuell gültig dagegen ist die Kfz-Steuerbefreiung für reine E-Fahrzeuge bis 2035 bei einer Zulassung bis Ende 2025. Ein deutlicher Steuervorteil ist auch die Möglichkeit, den Kaufpreis von Elektrofahrzeugen in den Jahren 2025-2027 zu 50 Prozent sofort abzuschreiben. Ab Juli 25 gilt dann eine degressive Abschreibung von 75 Prozent im ersten Jahr. Bei der Dienstwagenbesteuerung werden E-Autos bis zu einem Kaufpreis von 60.000 Euro statt mit einem vollen Prozent nur mit 0,25 Prozent des Listenpreises versteuert. Teurere Fahrzeuge mit 0,5 Prozent. Interessant ist auch die Förderung des Ministeriums für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIKE) für den Einbau von Ladestationen (bis zu 1.500 Euro). Das MWIKE fördert unter anderem den Aufbau von Ladeinfrastruktur an Wohnimmobilien – insbesondere für Mieterinnen und Mieter. Darüber hinaus haben auch Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, Fördermittel für die Installation von Ladepunkten zu beantragen – sowohl für die betriebliche Fahrzeugflotte als auch für die Nutzung durch Mitarbeitende. Darüber hinaus haben E-Auto-Besitzer die Möglichkeit, ihre THG-Quote (Zertifikat für die Vermeidung von CO2-Ausstoß) an Quoten-pflichtige Unternehmen, wie z.B. Mineralölkonzerne verkaufen.
Hauptsache günstig geladen
Wie bei Verbrennern gibt es bei E-Fahrzeugen deutliche Unterschiede im Energieverbrauch. So kommen Kleinwagen mit 13-15 kWh aus 100 Kilometer aus, während eine Oberklasse-Limousine 19-23 kWh benötigt und ein Transporter 24-30 kWh. Ob, oder um wieviel, der Energieverbrauch eines E-Fahrzeugs günstiger ist als der eines Verbrenners, ist von dem gezahlten Strompreis und der jeweiligen Fahrweise des Fahrzeugs abhängig. Daher ist es wichtig, ob ein Unternehmen über eine eigene Ladeinfrastruktur verfügt, oder auf öffentliche Ladestationen angewiesen ist. Optimal ist, wenn die eigene Ladestation mit Strom aus der PV-Anlage auf dem Dach gespeist wird und das Fahrzeug dort geladen werden kann, wo es ohnehin länger steht, z.B. auf dem Firmenparkplatz, was komfortabel ist und zu einer Entlastung der öffentlichen Ladeinfrastruktur führt. Dann kommt man mit 5-15 Cent pro kWh aus, und fährt unschlagbar günstig. Wesentlich teurer kann das Laden an öffentlichen Ladesäulen sein. Lädt man seinen Strom an einer öffentlichen Schnellladesäule können zum aktuellen Strompreis bis zu 80 Cent fällig werden, an einer normalen Ladesäule immer noch 40-50 Cent pro kWh. Ein überwiegend öffentlich geladenes, „energiehungriges“ E-Fahrzeug kann so teurer als ein entsprechender Verbrenner sein. „Wer bei E-Mobilität auf eigene Ladeinfrastruktur und nachhaltige Energiequellen setzen kann, fährt nicht nur günstiger, sondern auch zukunftssicher. Die intelligenteste Kilowattstunde ist die, die dort geladen wird, wo das Fahrzeug ohnehin steht – leise, sauber und wirtschaftlich. So wird Elektromobilität zur echten Win-win-Lösung für Unternehmen und Umwelt“, erklärt Dr. Matthias Dürr.
Weniger Geld für Wartung und Reparaturen
Bei Verbrennerfahrzeuge sind Wartung und Reparaturen ein wesentlicher Kostenfaktor als bei Elektrofahrzeugen. Viele kostentreibende Verschleißteile sind bei den Elektrischen gar nicht vorhanden und man benötigt weniger Betriebsflüssigkeiten. Dadurch verringert sich der Wartungsaufwand um durchschnittlich 30-50 Prozent, was bei einem Transporter 500-700 Euro im Jahr ausmachen kann, bei einem Mittelklassewagen immer noch 300-400 Euro. Vorteilhaft sind auch längere Wartungsintervalle und seltenere Werkstattaufenthalte. Idealerweise werden die Fahrzeuge in den Werkstätten der jeweiligen Fahrzeughändler gewartet, da diese auf die Anforderungen der jeweiligen Fahrzeuge ausgelegt sind. Beim Kauf eines gebrauchten Elektrofahrzeugs ist es häufig sinnvoll einen Batteriecheck ausführen zu lassen, um einen belastbaren Eindruck vom Zustand der Batterie zu bekommen. Den kostenpflichtigen Batteriecheck bieten zum Beispiel der TÜV Süd oder der Allgemeiner Deutscher Automobil-Club, ADAC an.
Für wen lohnen sich E-Fahrzeuge
Die Wirtschaftlichkeit des Umstiegs hängt von einer guten Planung und geschickten Umsetzung ab – und natürlich von den spezifischen Anforderungen der Branche und des Betriebs. Die Umstellung lohnt sich besonders für Branchen mit häufigen, gut planbaren Fahrten auf kurzen bis mittleren Distanzen – so zum Beispiel Kurier- und Lieferdienste, Handwerksbetriebe, Pflegedienste oder die Bau- und Immobilienwirtschaft. Wobei es wichtig ist, Einsatzplanung und Ladeinfrastruktur aufeinander abzustimmen. Interessant kann E-Mobilität auch für Branchen sein, die häufig in Innenstädte fahren müssen – und so Umweltzonen durchfahren und reine Elektro-Parkplätze nutzen können. Eine exakte Aussage kann allerdings auch hier nur individuell getroffen werden, wobei die jeweils neuen Rahmenbedingungen zu beachten sind.
„Die Technik entwickelt sich stetig weiter, neue Fahrzeugmodelle mit höheren Reichweiten kommen auf den Markt und auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur schreitet voran. E-Fahrzeuge werden damit immer mehr zur echten Alternative“, so die Einschätzung von Fabian Bannier, Referent für Mobilität bei der IHK Nord Westfalen. „Da die Kosten für fossile Mobilität in den nächsten Jahren voraussichtlich steigen werden, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, den Einstieg in die Elektromobilität zu schaffen und den Fuhrpark schrittweise umzurüsten oder Richtlinien für Dienstwagen anzupassen“, rät Bannier. „Mit Auto-Abos oder Carsharing gibt es heute außerdem verschiedene Möglichkeiten, die Fahrzeugflotte zu flexibilisieren und sich dem Thema Elektromobilität im Unternehmen zunächst einmal testweise zu nähern und Erfahrungen zu sammeln“.
Teilen: