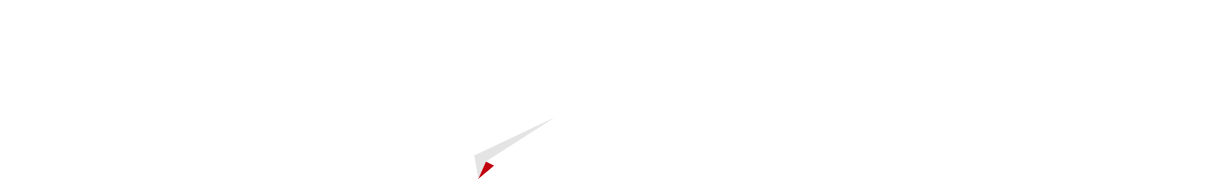Viele Unternehmen mit Sitz in NRW befinden sich gerade in einer Phase, in der sich die globalen Märkte schneller verändern als erwartet. Die Transportwege geraten unter Druck, politische Konflikte führen zu Unsicherheiten und wichtige Rohstoffe sind nicht jederzeit verfügbar.
In den vergangenen Jahren hatten zahlreiche Betriebe mit Verzögerungen bei ihrer Beschaffung zu kämpfen und mussten ihre Abläufe daher kurzfristig anpassen. Unternehmen, die heute ihre Lieferketten überprüfen, tun dies meist nicht aufgrund theoretischer Erwägungen, sondern weil sich die Realität spürbar verändert hat.
Gleichzeitig eröffnet diese Situation die Chance, etablierte Abläufe neu zu denken, die verbundenen Risiken zu verringern und damit die eigene Position im internationalen Wettbewerb zu festigen.
Globale Veränderungen im Blick behalten
Unternehmen in Deutschland sind traditionell stark in die internationale Wertschöpfung integriert. Dies zeigt sich unter anderem in Branchen wie dem Maschinenbau, der Elektrotechnik, der Lebensmittelverarbeitung oder der Chemie. Diese arbeiten seit Jahren eng mit Zulieferern aus Europa, Asien und Nordamerika zusammen.
Viele von ihnen beobachten, dass Transportpreise zeitweise deutlich schwanken, die Häfen und Logistikzentren an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen oder politische Entwicklungen einzelne Routen beeinflussen. Diese Veränderungen treffen mittelständische Firmen genauso stark wie globale Konzerne.
Diejenigen, die langfristig erfolgreich bleiben möchten, brauchen deshalb ein System, das auf plötzliche Störungen vorbereitet ist. Viele Entscheider:innen informieren sich beispielsweise gerne im Wirtschaftsmagazin, um neue Entwicklungen früher erkennen und einordnen zu können.
Regionale Strategien gewinnen an Bedeutung
Fokus auf europäische Beschaffungswege
Viele Betriebe prüfen aktuell, ob es für sie die Möglichkeit gibt, enger mit Partnern innerhalb Europas zusammenarbeiten zu können. Es geht dabei nicht um einen kompletten Umbau, sondern darum, Abhängigkeiten über sehr weite Distanzen zu minimieren.
Kürzere Lieferwege reduzieren das Ausfallrisiko und erleichtern gleichzeitig die Abstimmung zwischen Einkauf, Produktion und Logistik. Außendienstbesuche, Qualitätskontrollen oder technische Klärungen lassen sich schließlich wesentlich schneller umsetzen, wenn der Zulieferer nur wenige Flugstunden entfernt liegt.
Transparenz über die gesamte Kette
Eine der zentralen Anforderungen an moderne Lieferketten besteht außerdem darin, die eigenen Strukturen besser sichtbar zu machen: Wer liefert welche Teile? Welche Alternativen stehen zur Verfügung? Wo liegen kritische Punkte, die Produktionsabläufe beeinflussen könnten?
Viele Unternehmen nutzen dafür inzwischen interne Systeme, die Bestände, Bestellungen und Rückmeldungen der Zulieferer in Echtzeit bündeln. Diese Transparenz erleichtert die Planung und reduziert zudem das Risiko von überraschenden Engpässen. Daneben schaffen klar dokumentierte Abläufe Vorteile, wenn Prüfpflichten und regulatorische Anforderungen steigen.
Mehrgleisige Beschaffungsoptionen
Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass eine einzelne Bezugsquelle im Ernstfall nicht ausreicht. Immer mehr Unternehmen erstellen deshalb Szenarien für unterschiedliche Situationen und halten zweite oder dritte Lieferoptionen bereit.
Dies zeigt sich bei Metall- und Kunststoffverarbeitern ebenso wie bei Herstellern von Automatisierungstechnik oder speziellen Bauteilen. Auch zusätzliche Sicherheitsbestände werden wieder häufiger geprüft, vor allem dort, wo sich einzelne Komponenten besonders kritisch zeigen oder lange Fertigungszeiten berücksichtigt werden müssen.
So gelingt die Umsetzung im betrieblichen Alltag
Der Weg zu stabileren Lieferketten beginnt mit einer nüchternen Bestandsaufnahme. Welche Teile sind für die eigene Produktion unverzichtbar? Welche Regionen spielen die wichtigste Rolle? Welche Lieferanten haben in den vergangenen Jahren zuverlässig gearbeitet? Die Antworten auf diese Fragen bilden die Grundlage für eine realistische Einschätzung. Betriebe, die eine solche Analyse regelmäßig durchführen, sind in der Lage, Veränderungen früher zu erkennen und damit schneller zu reagieren.
In Gesprächen mit Verantwortlichen aus Logistik und Einkauf zeigt sich ein wiederkehrendes Muster: Störungen entstehen meist nicht durch ein einzelnes Ereignis, sondern durch viele kleinere Faktoren. Ein Stau im Hafen, ein Engpass in der Frachtkapazität, längere Bearbeitungszeiten im Zoll oder eine neue regulatorische Vorgabe reichen bereits aus, dass sich geplante Termine nach hinten verschieben.
Unternehmen, die ihre Abläufe gut dokumentieren und klare Kommunikationswege mit ihren Partnern pflegen, können solche Verzögerungen jedoch wesentlich besser kompensieren.
Kooperationen dienen als Stabilitätsanker
Regionale Netzwerke gewinnen somit wieder an Bedeutung. Viele Firmen aus NRW setzen vermehrt auf partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Zulieferern aus der Region oder dem angrenzenden Ausland.
Die räumliche Nähe erleichtert schnelle Absprachen, die kürzeren Transportwege reduzieren Risiken und steigern zudem die Planbarkeit. Zudem lässt sich beobachten, dass Unternehmen häufiger engere technische Kooperationen eingehen, damit Produkte schneller angepasst oder weiterentwickelt werden können. Diese Art der Zusammenarbeit stärkt sowohl die eigene Lieferkette als auch das gesamte regionale Wirtschaftsgefüge.
Kooperationen entlang der Wertschöpfungskette nehmen ebenfalls zu. Manche Betriebe stimmen sich so beispielsweise enger mit Transportdienstleistern, Hafenlogistikern oder Verpackungsherstellern ab. Damit verfolgen sie das Ziel, Abläufe zu entschlacken und in Folge Engpässe zu vermeiden.
Ein Beispiel dafür stellt die verstärkte Planung von Transportkapazitäten über längere Zeiträume dar, sodass rechtzeitig der nötige Frachtraum gesichert wird. Viele Unternehmen betonen, dass vor allem eine solch vorausschauende Logistikplanung mittlerweile entscheidend dafür ist, ob ein Auftrag termingerecht abgearbeitet werden kann.
Der Blick nach vorne
Eins ist bereits heute sicher: Die Lieferketten werden in Zukunft nicht einfacher. Doch Unternehmen, die ihre Strukturen genau kennen, flexibel planen und auf partnerschaftliche Zusammenarbeit setzen, schaffen eine solide Grundlage für diese Herausforderung.
Entscheidend bleibt, verlässlich zu bleiben – für die Kund:innen ebenso wie für die Geschäftspartner. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen, dass eine regionale Verankerung und eine internationale Ausrichtung kein Widerspruch sein müssen, sondern sich ergänzen. Betriebe, die sich lokal auf starke Partner verlassen können, bleiben somit auch global handlungsfähig.
Teilen: