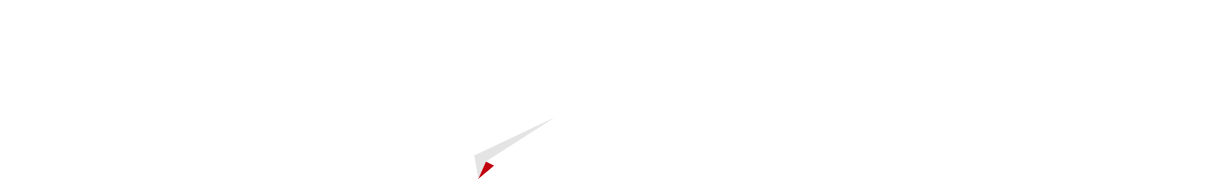Die Aussichten für den Hochbau bleiben durchwachsen und auch in NRW ist die Baukrise weiterhin spürbar. Vor allem der private Wohnungsbau bleibt hier aufgrund steigender Baukosten rückläufig. Die Folge: Materialkosten werden teurer, Aufträge und Fachkräfte weniger, der Bauüberhang wächst.
Trotz angespannter Lage bietet jede Krise auch Chancen. Mit der richtigen Förderung und gezielter Suche nach Ausschreibungen muss Neubau kein Luftschloss bleiben. Auftragnehmer können zudem durch mehr Mut zu digitaler Transformation, schlankere Prozesse und ein erfolgreiches Change Management die eigenen Erfolgschancen erhöhen.
Ist die Baukrise gekommen, um zu bleiben?
In Deutschland fehlt es an Wohnungen. Einfach neu bauen ist aber leichter gesagt, als getan, denn seit 2021/22 verschärft sich die Baukrise. Obwohl der Traum vom Eigenheim weiterlebt, fehlt immer öfter das Geld und damit auch der Wille zur Investition.
Öffentliche Aufträge dienen indes als stabilisierender Faktor im schwächelnden Hochbau: Im Vergleich zu Österreich und Schweiz steckt Deutschland deutlich mehr Geld in den Bausektor. Mehr oder günstiger gebaut wird dadurch aber trotzdem nicht. Ohne klare Trendwende im Wohnungsbau liegen der Weg aus der Krise sowie die angekündigten 400.000 Wohnungen jährlich in weiter Ferne.
Zumindest Experten prognostizieren eine Stabilisierung mit episodischen Besserungen. So ließen sich in NRW 2025 mehr Baugenehmigungen und sogar ein kleines Plus im Hochbau verzeichnen. Eine echte Trendwende sei aber frühestens ab 2027 zu erwarten. Zumindest, wenn die Baubranche mitzieht.
Gründe, warum Bauen in der Krise steckt
- Kontinuierlich steigende Kosten für Baumaterialien und Energie
- Teufelskreis aus mangelnden Aufträgen, Wohnraum und Fachkräften
- Steigende Bauzinsen erschweren Finanzierungen
- Lieferengpässe durch globale Krisen und Klimawandel
- Strengere Normen hinsichtlich Energieeffizienz
- Hohe Bau- und Grundstückspreise schrecken private Auftraggeber ab
- Verschleppte Digitalisierung und langsamer Innovationswille
Bauunternehmen müssen sich zukunftsfähig machen
Bauunternehmen dürfen in dieser angespannten Lage nicht passiv bleiben, sondern müssen proaktiven Wandeln fördern. Folgende Impulse können helfen:
- Öffentliche Aufträge nutzen: Öffentliche Bauaufträge bieten einen sicheren Anker in einer stürmischen Marktsituation. Vor allem Aufträge für Schulgebäude, Sporthallen, Infrastrukturprojekte und Verwaltungen ermöglichen Planungssicherheit.
- Ausschreibungsportale nutzen: Effizienz und Flexibilität bei der Recherche von Vergaben ist gefragt. Online-Portale für Ausschreibungen im Hochbau helfen durch zentrale Auftragsbündelung bei der Suche. Durch präzise Suchfunktionen lassen sich aktuelle Aufträge mit detailliertem Auftragsprofil auf eigene Anforderungen, Regionen und Qualifikationen abstimmen und finden.
- Digitale Transformation fördern: Bau- und Planungssoftware sowie weitere digitale Tools müssen insbesondere in kleinen und mittleren Bauunternehmen stärker zur Anwendung kommen. So lassen sich Routineprozesse verkürzen und automatisieren und die Einhaltung von Bauvorgaben durch automatisierte Workflows, 3D-Planungssysteme und Qualitätskontrollen prüfen. Mehr Digitalisierung spart Kosten und Zeit und hilft dabei, Bauprojekte schneller, günstiger und effizienter fertigzustellen. Die Früherkennung von Risiken, das Recruiting von Fachkräften sowie die Prozessoptimierung durch Digitalisierung stärken zusätzlich die Wettbewerbsfähigkeit.
- Flexibilität und Innovation: Um von öffentlichen und privaten Aufträgen zu profitieren, müssen Bauunternehmen sich an veränderte Marktsituationen flexibel anpassen. Dabei helfen zum Beispiel nachhaltige Strategien für flexible Preisanpassungen, vereinfachte und automatisierbare Bauweisen durch mehr Fertig- und Modulbau, flexiblere und nachhaltigere Materialwahl (Holz, Hanf, recycelter Beton) sowie effizientere Grundstücksnutzung durch kleinere Wohnungen und mehr Geschosse.
- Umorientierung: Solange der Neubaustau anhält, lohnt sich ein Fokus auf Modernisierung, Sanierung sowie Umbau und Aufstockung von Bestandsimmobilien. Die Nachfrage unter Bestandsimmobilien steigt und das nachhaltige Renovieren und „Auffrischen“ älterer Gebäude lohnt sich für Auftraggeber unter Umständen mehr als ein Neubau.
Besteht Aussicht auf Besserung für die Baubranche?
Pessimismus ist fehl am Platz, denn mit den richtigen Impulsen lässt sich der Wohnungsbau wieder ankurbeln. In diesem Zusammenhang hat der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie schon 2024 zehn Impulse definiert, die es für einen neuen Aufschwung braucht:
- Mehr Entscheidungsbefugnisse für das Ministerium für Bauen und Klimaschutz
- Herunterfahren staatlicher Überregulierung in der Immobilienbranche
- Vereinheitlichung der Landesbauordnungen
- Mehr langfristige Planungssicherheit in der Bauförderung
- Senkung der Grunderwerbssteuer, Mehrwertsteuer sowie erleichterte Steuerabschreibungen
- Fokus auf innovative Bauverfahren und Bauweisen zur CO2-Reduzierung statt strenge Effizienzhausnormen
- Wohneigentumsbildung durch Steuer- und Erwerbsnebenkostensenkungen fördern
- Standardisierung und Bündelung der Zuwanderung von Arbeits- und Fachkräften aus In- und Ausland
- Mehr digitale Transformation in der Bauwirtschaft für Planungs- und Bauprozesse sowie für Baugenehmigungen
- Anpassung des Paragrafen 246 im Baugesetzbuch für vereinfachende Sonderregeln im Mietwohnungsbau und beschleunigte Baustarts
Mit dem am 9. Oktober 2025 verabschiedeten Bau-Turbo in Form des Paragrafen 246e ging die neue Bundesregierung bereits auf Punkt 10 ein. Ob damit wirklich die angekündigte „Beschleunigung des Wohnungsbaus“ möglich wird, muss sich erst noch zeigen.
Teilen: