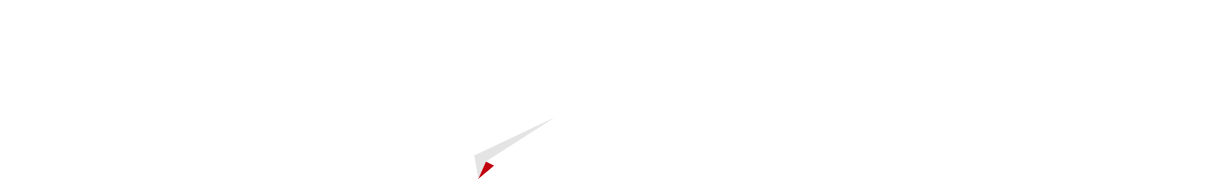Der Schock saß tief, als NetDragon Websoft im August 2022 verkündete, eine Künstliche Intelligenz zur Geschäftsführerin zu ernennen. Tang Yu, so der Name der digitalen Chefin, sollte fortan den 2,1-Milliarden-Dollar-Konzern lenken – rund um die Uhr, ohne Gehalt, ohne Urlaub. Was als PR-Gag abgetan wurde, entpuppte sich als ernsthafte Geschäftsstrategie: Die Aktie des chinesischen Gaming-Konzerns legte nach der KI-Ernennung messbar zu – mehrere Medien berichteten über einen deutlichen Kursanstieg, während der Gesamtmarkt schwächelte.
Wenige Monate später folgte der polnische Spirituosen-Hersteller Dictador mit „Mika“, einem humanoiden KI-Roboter als CEO. Die Botschaft war klar: Künstliche Intelligenz macht auch vor dem Chefsessel nicht halt. Doch was steckt wirklich hinter diesen digitalen Führungsexperimenten? Und vor allem: Was erlaubt der neue EU-AI Act überhaupt bei KI-gesteuerten Entscheidungen?
Die Pioniere zeigen, wie es geht
Tang Yu ist kein normaler Angestellter. Die KI-Dame arbeitet 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche – ohne je müde zu werden. Über 300.000 Genehmigungsformulare hat sie bereits bearbeitet, knapp 500.000 Aufgaben-Erinnerungen verschickt und über 40.000 Kollegen jährlich betreut. 2024 wurde sie als „China’s Best Virtual Employee of the Year“ ausgezeichnet.
„Tang Yu übernimmt einen Großteil der Alltagsentscheidungen und kümmert sich um den Markenaufbau“, erklärt NetDragon-Chairman Dejian Liu. Der Erfolg gibt ihm recht: Das Unternehmen performt seit der KI-Ernennung deutlich besser als der Markt. Auch bei Dictador übernimmt KI-CEO Mika klassische Führungsaufgaben: Kunden-Akquise, Risikobewertung und die Auswahl von Künstlern für Flaschen-Designs. „Meine Entscheidungen basieren auf umfangreichen Datenanalysen und sind frei von persönlichen Vorurteilen“, erklärt Mika in Interviews.
Was besonders beeindruckt: Diese KI-Chefs arbeiten nicht isoliert, sondern sind in komplexe Organisationsstrukturen eingebettet. Tang Yu hat beispielsweise ein ganzes Team von „AI Employees“ aufgebaut, das verschiedene Unternehmensbereiche abdeckt. Von der Dokumentenprüfung über Projektüberwachung bis zur Mitarbeiter-Performance – die digitalen Kollegen übernehmen systematisch Aufgaben, die früher Führungskräfte beschäftigt haben. Doch diese Entwicklung wirft fundamentale Fragen auf: Können Algorithmen wirklich bessere Chefs sein als Menschen? Und was bedeutet das für die Zukunft der Unternehmensführung?
Was der AI Act erlaubt – und was nicht
Seit Februar 2025 gelten in der EU neue Regeln für Künstliche Intelligenz. Der AI Act kategorisiert KI-Systeme nach Risikostufen – und setzt klare Grenzen. Verboten sind manipulative KI-Systeme, die Menschen unbewusst beeinflussen, sowie Social-Scoring-Systeme, die Bürger nach ihrem Verhalten bewerten.
Besonders relevant für KI-Chefs: Artikel 14 des AI Acts schreibt „menschliche Aufsicht“ vor. Das bedeutet: KI darf unterstützen und vorschlagen, aber wichtige Entscheidungen müssen von Menschen überwacht werden. „KI-Systeme müssen so konzipiert werden, dass sie der angemessenen menschlichen Aufsicht unterliegen“, heißt es im Gesetzestext.
Außerdem müssen Unternehmen seit Februar 2025 sicherstellen, dass ihre Mitarbeiter über „ausreichende KI-Kompetenz“ verfügen. Wer KI-Systeme nutzt oder entwickelt, braucht entsprechende Schulungen. Die Botschaft ist klar: KI als Werkzeug ja, als unkontrollierter Entscheider nein.
Zwischen Erfolg und Ernüchterung
Die Realität zeigt: KI-Projekte sind ein zweischneidiges Schwert. Verschiedene Studien schätzen, dass zwischen 70 und 85 Prozent aller KI-Projekte scheitern. Die Gründe sind vielfältig: mangelhafte Datenqualität, unrealistische Erwartungen und fehlende Change-Management-Prozesse.
Ein drastisches Beispiel lieferte 2024 die Software SafeRent in den USA. Das KI-System sollte Wohnungsbewerbungen bewerten, wurde aber juristisch belangt und zu einer millionenschweren Vergleichszahlung verpflichtet. Auch Chatbots sorgen regelmäßig für Schlagzeilen – wenn sie Nutzer beleidigen oder unangemessene Antworten geben, wie 2024 bei verschiedenen KI-Systemen geschehen.
Trotzdem wächst der KI-Einsatz rasant. „Abwarten und Nichtstun ist bei Künstlicher Intelligenz die falsche Strategie“, mahnt Dr. Ralf Wintergerst, Präsident des Digitalverbands Bitkom. Laut Bitkom-Studien nutzt bereits etwa jedes fünfte deutsche Unternehmen KI, drei Viertel planen Investitionen in den kommenden Jahren.
Wo Menschen unersetzlich bleiben
Bei aller Euphorie: KI hat klare Grenzen. „Überall dort, wo es um zwischenmenschliche Beziehungen, Vertrauen oder Wertschätzung geht, werden Menschen unersetzlich bleiben“, erklärt Barbara Stöttinger, Dekanin der WU Executive Academy, in Interviews. Empathie, Kreativität und ethisches Urteilsvermögen – diese ureigenen menschlichen Fähigkeiten kann keine Maschine ersetzen.
Auch die KI-CEO-Pioniere setzen Grenzen. Bei NetDragon bleiben strategische Personalentscheidungen wie Einstellungen und Entlassungen in menschlicher Hand. „Wichtige und bedeutende Entscheidungen liegen weiterhin beim menschlichen Führungsteam“, betont Dictador-Präsident Marek Szoldrowski.
Die Wahrheit liegt vermutlich irgendwo dazwischen: KI als mächtiges Werkzeug für Datenanalyse und Routineaufgaben, Menschen als finale Entscheider für komplexe und ethische Fragestellungen. Das Stichwort heißt „Augmented Leadership“ – KI-unterstützte, aber menschlich geführte Unternehmen.
Der Fahrplan für KI-gestützte Führung
Was können deutsche Mittelständler von den KI-CEO-Pionieren lernen? Drei zentrale Erfolgsfaktoren kristallisieren sich heraus:
Erstens: Klare Aufgabentrennung. KI übernimmt Datenanalyse, Mustererkennung und Prozessoptimierung – Menschen behalten Kreativität, Empathie und strategische Visionen. Zweitens: Schrittweise Einführung. Statt gleich einen KI-Chef zu installieren, beginnen erfolgreiche Unternehmen mit einzelnen Pilotprojekten in abgegrenzten Bereichen. Drittens: Kontinuierliche Weiterbildung der Mitarbeiter, damit diese mit KI-Systemen effektiv zusammenarbeiten können.
Die Herausforderung für Führungskräfte: Sie müssen lernen, KI-generierte Insights zu interpretieren und in menschliche Entscheidungen zu übersetzen. Das erfordert neue Kompetenzen – von Datenverständnis bis zur Technologie-Ethik.
Revolution oder Evolution?
Die ersten KI-CEOs sind weniger Revolution als intelligente Evolution bestehender Geschäftsprozesse. Sie übernehmen vor allem repetitive Aufgaben, Datenauswertung und Prozessoptimierung – Bereiche, in denen Algorithmen Menschen tatsächlich überlegen sind.
Für mittelständische Unternehmer in NRW bedeutet das: KI wird kommen, aber nicht als Ersatz, sondern als Verstärkung menschlicher Fähigkeiten. Wer jetzt die Weichen stellt – durch Mitarbeiterschulungen, klare KI-Strategien und schrittweise Implementierung –, kann von der Technologie profitieren, ohne die menschliche Komponente zu verlieren.
Dabei müssen Unternehmer realistisch bleiben: Ein KI-System wie Tang Yu kostet Millionen in der Entwicklung und Wartung. Für kleinere Betriebe sind jedoch bereits einfachere KI-Tools verfügbar, die ähnliche Effekte erzielen können – von der automatisierten Rechnungsbearbeitung bis zur intelligenten Kundenbetreuung. Entscheidend ist die richtige Balance: KI für Routine und Datenverarbeitung, Menschen für Kreativität und komplexe Entscheidungen. Unternehmen, die diese Aufteilung meistern, werden ihre Wettbewerbsfähigkeit deutlich steigern können. Die Frage ist nicht, ob KI Chefs überflüssig macht. Die Frage ist, welche Chefs bereit sind, mit KI zu arbeiten – und welche sich von jenen überholen lassen, die es tun.
Teilen: