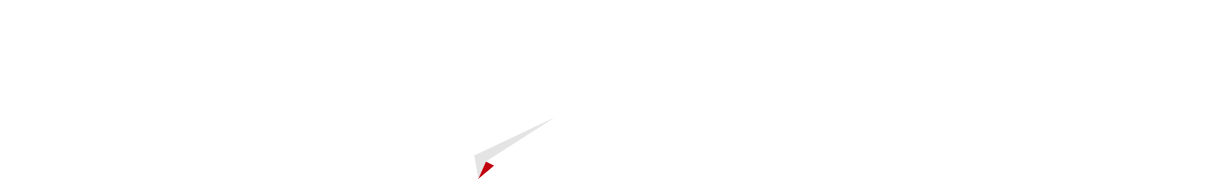Mailen, skypen, chatten, surfen: Die Digitalisierung hat den Arbeitsalltag in deutschen Büros bereits spürbar verändert. Für Führungskräfte birgt sie deshalb neue Herausforderungen. „Durch die Computerisierung und der zunehmenden Vielfalt der Kommunikationsmittel müssen Menschen, die an einem Projekt arbeiten, nicht mehr zwangsläufig in einem Unternehmen zusammenkommen. Stattdessen können die beteiligten Personen an jedem Ort der Welt tätig werden und von dort aus mit ihren Kollegen oder Vorgesetzten in Echtzeit kommunizieren“, erklärt Wirtschaftsethiker Ulf D. Posé. „Das hat zur Folge, dass Führungskräfte weniger Zugriff auf den Mitarbeiter haben als früher, da sie ihn viel seltener zu Gesicht bekommen.“
Soziale Kompetenz beweisen
Die Anzahl der direkten Kontakte hat somit stark abgenommen. „Während früher jährlich circa 50 bis 60 persönliche Gespräche zwischen Chef und Mitarbeiter geführt wurden, sind es heute lediglich drei bis fünf“, so der freie Dozent für Dialektik und Führungslehre. „Deshalb muss die Qualität der Gespräche zunehmen. Sehen wir einen Menschen 50-mal im Jahr, ist es nicht schlimm, wenn mal ein Gespräch schiefgeht. Schließlich können Missverständnisse beim nächsten zeitnahen Aufeinandertreffen wieder korrigiert werden. Wenn wir den Mitarbeiter aber nur noch dreimal treffen, dann muss jedes einzelne Gespräch gut laufen.“ Andernfalls liegt eine Klärung in weiter Ferne und das Verhältnis zwischen den Gesprächspartnern könnte leiden. Die Aufmerksamkeit für gute Kommunikation müsse folglich zunehmen. Aus diesem Grund werden soziale Kompetenzen bei der Führung von Mitarbeitern immer wichtiger. „Allerdings wird dieser Faktor heute nicht immer berücksichtigt, da wir in einer Zeit leben, in der alles schnell gehen muss.“ Anstatt einen persönlichen Gesprächstermin zu vereinbaren, greifen viele Führungskräfte eher zum Telefonhörer, wenn wichtige Themen auf der Agenda stehen. Da beim Verstehen des Gegenübers aber auch Gestik und Mimik eine Rolle spielen, kann ein Telefonat ein Vor-Ort-Gespräch nicht ersetzen. Für Probleme im Arbeitsalltag sorgen auch Missverständnisse, die beim Schreiben von E-Mails entstehen; nicht selten wird der Tonfall der Nachricht vom Empfänger falsch oder negativ interpretiert. Klärung kann dann nur ein persönliches Gespräch bringen.
Generation 4.0 fordert Flexibilität
Doch nicht nur die Kommunikationsmittel haben sich in Zeiten der Digitalisierung verändert, sondern auch die Mitarbeiter. Junge Menschen, die mit mobiler Kommunikation in einer vernetzten Welt aufgewachsen sind, haben heute andere Ansprüche an potenzielle Arbeitgeber als ältere Kollegen. Da sie sich Flexibilität und Selbstbestimmung wünschen, arbeiten sie lieber im Homeoffice oder sogar unterwegs. „Für die Generation Y ist die Work-Life-Balance wichtiger als eine steile Karriere. Junge Leute wollen sich gesellschaftlich engagieren und suchen nach Selbstverwirklichung.“ Statussymbole wie Dienstwagen oder die Reputation eines Unternehmens spielen für die sogenannten Digital Natives eine untergeordnete Rolle. Stattdessen wollen sie sich mit interessanten Projekten beschäftigen und in virtuellen Teams arbeiten. Gleichzeitig bindet sich die Generation Y nicht stark an ein Unternehmen und zeigt auch eine weitaus niedrigere Bleibebereitschaft als die Vorgängergeneration. Im Kampf um die Köpfe von morgen wird es deshalb für Manager wichtig sein, auf die Ansprüche dieser Mitarbeiter Rücksicht zu nehmen und sich auf veränderte Arbeitsweisen einzustellen. „Darüber hinaus wird die Führungsspanne immer größer, da es immer mehr Mitarbeiter gibt, die geführt werden müssen. Daneben steigt die Zahl der zu bearbeitenden Projekte: So hat ein Mitarbeiter, der an zehn Projekten arbeitet, möglicherweise auch zehn verschiedene Vorgesetzte, mit denen er sich auseinandersetzen muss. Das sind dann zwar keine weisungsgebundenen, aber durchaus sachlich gebundene Verhältnisse“, erklärt Posé. „Aus diesem Grund muss sich der Führende mit neuen Fragestellungen auseinandersetzen: Wie viel führe ich noch? Bin ich überhaupt noch mit meinem Mitarbeiter in einem direkten Dialog? Reden wir über Projekte, die aus meiner Feder stammen, oder über Dinge, die der Mitarbeiter bei anderen fachlich Vorgesetzten erlebt?“ Ausführlich wird mit den Mitarbeitern dennoch nur selten gesprochen; zugenommen hat hingegen die Zahl der kurzen Absprachen. Teams treffen sich eher bei kurzfristig einberufenen Meetings, um sich schnell abzustimmen, oder kommunizieren per Instant Messaging. „Dabei nimmt aber auch die Qualität der Arbeitsergebnisse ab, da die Menschen vor lauter Meetings und Nachrichten gar nicht mehr zum Arbeiten kommen.“ Die Aufgabe des Managers ist es nun, einen Weg zu finden, diese neuen Formen der Kommunikation sinnvoll zu nutzen. Vor allem sollte er mit gutem Beispiel vorangehen und sich Zeit für Gespräche nehmen, damit der persönliche Kontakt nicht auf der Strecke bleibt. „Wir müssen uns sehen, um einzuschätzen, ob wir uns aufeinander verlassen können.“
Internet: Goldgrube oder Müllhalde?
In dieser schnelllebigen Welt verändert sich zudem die Art des Lernens: „Oftmals fehlt die Zeit, bestimmte Dinge zu lernen, zu prüfen und/oder zu entscheiden. Es muss immer schnell gehen.“ Das sei auch im Seminarbereich feststellbar: Fähigkeiten, die früher noch in fünftägigen Kursen vermittelt wurden, sollen heute in Zwei-Tages-Seminaren oder Webinaren erlernt werden. „Allerdings sind Unternehmen, die erfolgreich sein wollen, vom Wissen ihrer Mitarbeiter abhängig. Auch die Generation Y will sich kontinuierlich weiterbilden und erwartet vom Arbeitgeber entsprechende Angebote.“ Gleichzeitig sei Vorsicht bei der Nutzung des World Wide Web geboten: „Viele Menschen glauben, sie hätten mit dem Internet das Wissen der Welt gepachtet. Dabei ist es Goldgrube und Müllhaufen zugleich.“ Sowohl der Chef als auch die Mitarbeiter müssten nun lernen, das eine vom anderen zu unterscheiden.
Dass sie sich auf neue Verhältnisse einstellen müssen, hätten Manager bereits verstanden. Allerdings sei eine komplette Abkehr von bewährten Prozessen nicht notwendig. „Schon vor 2.500 Jahren standen Chefs den gleichen Anforderungen gegenüber: Sie mussten mit Menschen umgehen und wirtschaftliches Handeln mit sozialem Miteinander verträglich gestalten können.“ Auch Mitarbeiter würden sich mit den gleichen Themen wie damals beschäftigen. Sie fragen sich: Wie steht mein Chef zu mir? Kann ich meinem Vorgesetzten auch kritisch sagen, was ich von ihm halte? Wie gehen wir miteinander um? Wie dogmatisch ist mein Chef? Kann ich mit ihm Konflikte lösen? Haben wir eine Vertrauenskultur? „Der Mensch ist immer noch ein Mensch. Deshalb sind die Führungsprozesse an sich gleich geblieben, nur die Rahmenbedingungen haben sich verändert. Manager müssen sich daran zwar anpassen, aber nicht ihre komplette Führung auf den Kopf stellen.“ Verpassen sie es jedoch, sich auf die neuen Anforderungen einzustellen, dann werden sie von Wettbewerbern ganz sicher überholt. Jessica Hellmann | redaktion@regiomanager.de
Teilen: