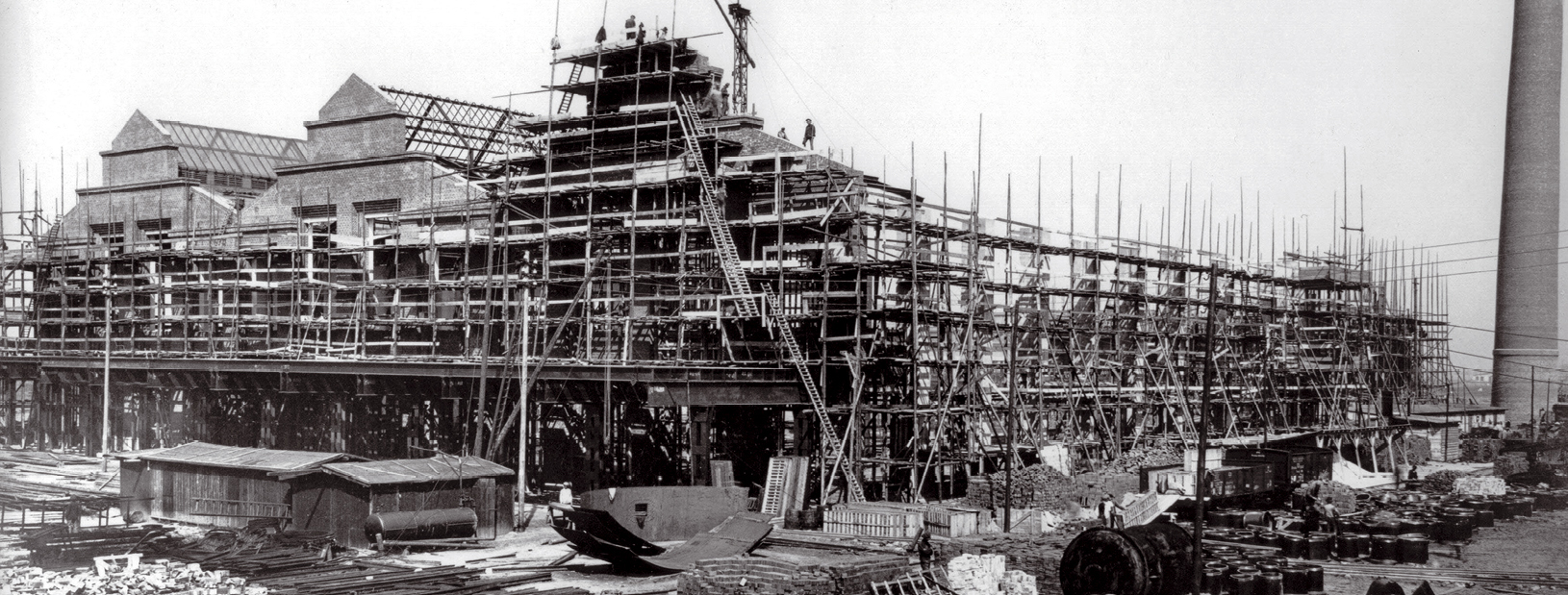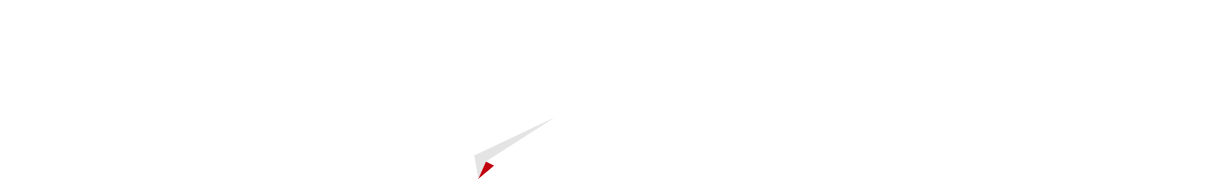Idyllisch
gelegen im Viereck zwischen Köln, Aachen, Mönchengladbach und
Düsseldorf, erscheint der Rhein-Kreis Neuss mit seinen sechs Städten
Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch und Neuss
sowie den Gemeinden Jüchen und Rommerskirchen als Oase der Wirtschaft.
Viele verschiedene Traditionsunternehmen vom kleinen Handwerksbetrieb
bis zum Global Player nennen den Kreis ihre Heimat und haben die
Wirtschaft der historisch landwirtschaftlich verorteten Region geprägt.
Von der Landwirtschaft zum Hightech-Standort
Dormagen
kann ob seiner römischen Ursprünge auf eine fast 2.000-jährige
Geschichte zurückblicken und war bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts
deutlich landwirtschaftlich geprägt. Diese Prägung machte sich im Jahre
1864 durch die Gründung einer Zuckerfabrik durch das Kölner Unternehmen
Rath, Joest & Carstanjen bezahlt. Begünstigt wurde diese
Industrialisierung durch die 1855 eröffnete Eisenbahnverbindung zwischen
Köln und Neuss. Fast ein halbes Jahrhundert war das Unternehmen der
einzige Großbetrieb mit mehr als 300 Beschäftigten. Dies sollte sich
erst mit dem heute wohl wichtigsten Traditionsunternehmen der Region
ändern. Bereits 1913 hatten die weltweit operierenden Leverkusener
Farbenfabriken, heute bekannt als Bayer AG, mit dem Ankauf von
Grundstücken in Dormagen begonnen. Dabei ging es den Verantwortlichen
zunächst nicht um eine industrielle Nutzung. Was das Unternehmen suchte,
war vielmehr Lagerraum für die in Leverkusen nicht mehr
unterzubringenden Schlamm- und Schuttmengen. Erst unter den Vorzeichen
des Krieges rückte die Unternehmensleitung von ihren Plänen ab und ließ
auf dem Dormagener Gebiet eine neue Fabrikanlage zur Erzeugung von
Pikrinsäure errichten. Ende Dezember 1917 wurden bereits 2.671 direkte
Betriebsangehörige gezählt; im Sommer 1918 war ihre Zahl auf deutlich
über 3.000 gestiegen. Obwohl Anfang 1918 nur etwa 30 Prozent der
Beschäftigten in Dormagen wohnten, waren die neu errichteten
Farbenfabriken der bei Weitem größte Arbeitgeber vor Ort und prägten
bereits ab 1925 mit der Entwicklung zum Faserwerk die Stadt. Spätestens
in den 1950er- und 1960er-Jahren, als das Werk rapide wuchs und Dormagen
durch die Produktion von Perlon und Dralon zum wichtigsten
Chemiefaserstandort Europas aufstieg, boomte auch der Wohnungsbau, und
von der einst landwirtschaftlich geprägten Region mit 8.500 Einwohnern
in 1871 wuchs Dormagen dank Bayer binnen eines Jahrhunderts zu einer
Stadt mit 56.000 Bürgern. Heute ist das Werk als Chempark Dormagen mit
35 ansässigen Unternehmen einer der wichtigsten Standorte im Kreis und
zählt über 10.000 Mitarbeiter.
Von Stahl zu Seide
Was
Bayer für Dormagen ist, ist das Traditionsunternehmen Böhler für
Meerbusch. Der erste Spatenstich für das Böhler-Stahlwerk im heutigen
Stadtteil Büderich, an der Stadtgrenze zu Düsseldorf, erfolgte im März
1914. Schon 1915 konnten die ersten Bereiche die Produktion aufnehmen
und im Jahr 1919 umfasste die Belegschaft mehr als 2.500 Mitarbeiter.
1933 begann ein großzügiger Ausbau des Werkes und später die teilweise
Umstellung auf Rüstungsproduktion. In den Jahren von 1960 bis 1970
wurden große Investitionen getätigt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu
erhalten, und so konnte das Werk in den 1980ern rund 3.700 Mitarbeitern
einen Job sichern. Ab 1991 folgte dann ein radikaler Erneuerungsprozess
für den Standort, bei dem Stahlwerk und Schmiede in Meerbusch
geschlossen wurden. Das Areal Böhler hat sich mittlerweile zum modernen
Gewerbepark und Messestandort entwickelt, in dem fast 200 Unternehmen
mit über 1.000 Mitarbeitern tätig sind. In der Alten Schmiedehalle haben
Messen wie die Rheingolf, die Neocom oder TrauDich eine Heimat
gefunden. Seit 2016 ist hier auch die Mode zu Hause. So haben mit der
Igedo Company Ordermessen- und Modenschauen auf dem Areal Böhler Einzug
gehalten. Werfen wir doch nun mal einen Blick in das prosperierende
Kaarst. Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt war bis zum Zweiten
Weltkrieg wesentlich durch Landwirtschaft und zugehörige
Verarbeitungsbetriebe geprägt. Trotzdem finden sich auch heute noch in
Kaarst klassische Traditionsunternehmen wie die Firma Schmitz & Sohn
im Ortsteil Holzbüttgen. Der heute generationsübergreifend geführte
Handwerksbetrieb wurde bereits 1880 gegründet. Seitdem hat sich das
Unternehmen als Schlosserei, Schmiede und im Bereich Metallbau als feste
Größe etabliert. In Handarbeit gefertigt, werden in der eigenen
Werkstatt heute Haustüren, Gitter, Geländer, Fenster, Garagentore,
Vordächer, Überdachungen und Treppen hergestellt.
Das braune Gold und
die Aluminiumhütte
Last, but not least bleiben uns bei den
Traditionsunternehmen im Rhein-Kreis Neuss noch der deutlich sichtbare
Braunkohletagebau durch die Rheinische AG für Braunkohlenbergbau und
Brikettfabrikation – später Rheinbraun und dann RWE – sowie die
Aluminiumhütten. Der Braunkohleabbau hat die Gegend um Grevenbroich bis
heute geprägt, Landschaften auf den Kopf gestellt und für Jahrzehnte
unserer Wirtschaft in NRW als treuer Energiespender zur Seite gestanden.
So kritisch man die heutige Nutzung auch hinterfragen möchte und die
roten Zahlen zur Kenntnis nimmt, so wichtig war die Braunkohle für den
Rhein-Kreis Neuss. Die Braunkohlevorkommen von Buchholz und Neurath
wurden durch Zufall beim Bau eines Brunnens im Jahre 1858 entdeckt und
zunächst Untertage abgebaut. 1869 stellte man die Förderung wegen
Absatzmangels wieder ein und erst 40 Jahre später sollte man sich wieder
der Braunkohle zuwenden. 1907 hatten sich die Preise für die Braunkohle
erhöht und es war nun auch möglich, diese mit sogenannten
Dampf-Eimerkettenbaggern im Tagebau zu fördern. Auch wurde im Jahre 1909
und 1912 jeweils eine Brikettfabrik errichtet, die beide bis 1968 in
Betrieb bleiben sollten. Aus dem einstigen Tagebau in Neurath ist durch
stetige Erweiterung bis heute eines der größten Tagebauareale in Europa
entstanden. Der Tagebau in Neurath selbst wurde mittlerweile komplett
rekultiviert; unter anderem mit einem kleinen See. Zudem steht auf
Gelände der Brikettfabrik das 1972 in Betrieb genommene Kraftwerk
Neurath. Heute erlebt die Braunkohle einen holprigen Strukturwandel,
während ein anderes Traditionsunternehmen aus Grevenbroich den Werkstoff
der Zukunft geprägt hat wie kein anderes Unternehmen im Kreis. Die Rede
ist von den beiden Werken der Vereinigten Aluminium-Werke und ihrer
Nachfolger, heute Norsk Hydro. Auch hier sollte der Erste Weltkrieg eine
besondere Rolle spielen. Denn als im Laufe des Krieges der Mangel an
Metallen immer deutlicher wurde, entschied man sich im September 1916
dazu, eine neue Aluminiumhütte inklusive Elektrodenfabrik nahe der
Braunkohlenwerke und der Bahnlinie zwischen Mönchengladbach und Köln zu
errichten. Exakt 50 Jahre später sollte ein zweites Werk in Norf bei
Neuss entstehen. Und so ergänzten sich lange Zeit zwei
Traditionsunternehmen der Region ganz im Sinne der wirtschaftlichen
Entwicklung des Rhein-Kreises Neuss. André Sarin | redaktion@niederrhein-manager.de
Teilen: