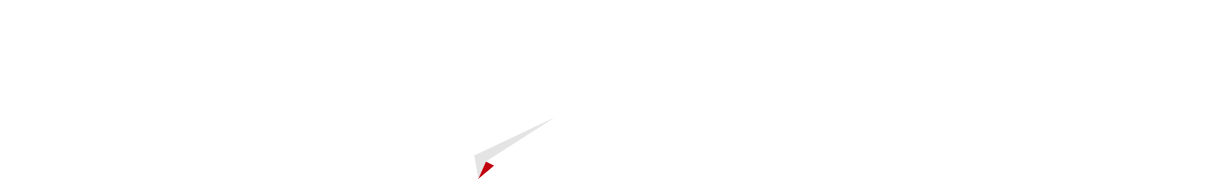Dass
der Altersdurchschnitt der Bevölkerung durch die Verkettung von
steigender Lebenserwartung und geringen Nachwuchszahlen in Deutschland
immer stärker steigt, das ist weithin bekannt. In der Folge wächst auch
die Zahl der pflegebedürftigen, kranken und alten Menschen, wie wir
bereits in unserem „Branchenreport zur ambulanten Pflege“ beleuchtet
haben. Im Jahr 2013 zählten 2,63 Millionen Menschen hierzulande zur
Gruppe der Pflegebedürftigen im Sinne des Pflegeversicherungsgesetzes
(SGB XI). Die Prognose von Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe:
„Zurzeit sind bei uns rund 2,6 Millionen Menschen aus den
unterschiedlichsten Gründen auf Pflege angewiesen. In den kommenden
eineinhalb Jahrzehnten wird sich die Zahl, Schätzungen zufolge, um knapp
eine Million Menschen vergrößern, sodass im Jahr 2030 rund 3,5
Millionen Menschen auf pflegerische Hilfe angewiesen sein werden.“ Zuletzt
wurden rund 71 Prozent der Pflegebedürftigen zu Hause von Angehörigen
oder ambulanten Pflegediensten versorgt, so das Statistische Bundesamt
in der aktuellen Pflegestatistik, die seit 1999 alle zwei Jahre
veröffentlicht wird. Das heißt, rund 29 Prozent finden gegenwärtig Hilfe
und Fürsorge in einem stationären Pflegeheim. Im Dezember 2013 gab es
rund 13.000 voll- bzw. teilstationäre Pflegeheime, von denen sich 7.100
bzw. 54 Prozent in sogenannter „freigemeinnütziger“ Trägerschaft
befanden, also von sozialen Einrichtungen wie der AWO, der Diakonie oder
der Caritas geleitet wurden. Die öffentliche Hand war nur bei fünf
Prozent der Pflegeheime verantwortlicher Träger. Im Gegensatz zur
„ambulanten Pflege“, die zum überwiegenden Teil privatwirtschaftlich
organisiert ist, drehen sich hier also die Verhältnisse um. Im Vergleich
zu 2011 verzeichnete die stationäre Versorgung ein Wachstum von 5,5
Prozent bei der Zahl der Heime insgesamt.
Deutlich mehr Tagespflege
10.900
der 2013 gezählten Einrichtungen boten an ihren Standorten eine
vollstationäre Dauerpflege. In Plätzen ausgedrückt: Von insgesamt
903.000 Pflegeplätzen waren 848.000 (94 Prozent) für die stationäre
Dauerpflege vorgesehen, und hierbei wurden wiederum 529.000
Dauerpflegeplätze als Ein-Bett-Zimmer angeboten sowie 314.000 Plätze in
Zwei-Bett-Zimmern. Das Wachstum lag hier bei zwei Prozent bzw. 17.000
Plätzen im Vergleich zur Pflegestatistik 2011. Einen
überdurchschnittlich großen Anstieg verzeichnet die Pflegestatistik bei
der Zunahme der Plätze für die teilstationäre Tagespflege. Mit rund
10.000 Plätzen wurden hier um 29,8 Prozent mehr Möglichkeiten geboten,
Angehörige kurzzeitig professionell pflegen zu lassen. Ein Zeichen
dafür, dass viele Angehörige mit den privaten Pflegemöglichkeiten
zeitlich und körperlich an ihre Grenzen stoßen? Die Zahl der
teilstationär betreuten Pflegedürftigen nahm um 30,6 Prozent (13.000
Plätze) zu. Bei den Pflegebedürftigen waren es zu 94 Prozent alte
Menschen, die in den Häusern versorgt wurden. Die Zahl der Heime für die
Pflege von Behinderten oder aber für psychisch kranke Menschen war im
Vergleich dazu mit zwei bzw. drei Prozent verschwindend gering. Hingegen
hatte nur rund jedes fünfte Pflegeheim ein unmittelbar angeschlossenes
Altenheim oder bot Möglichkeiten für betreutes Wohnen an. Diese
Situation zeigt, dass Altenheime und Seniorenhäuser für Menschen ohne
Pflegestufe eine überwiegend eigenständig organisierte Kategorie sind.
Kenngröße Pflegestufe
Die
„Pflegestufe“ ist derzeit noch die entscheidende Kenngröße bei der
Feststellung der Pflegebedürftigkeit. Sie wird durch den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen (MDK) ermittelt. Durch ärztliche Befunde und
Gespräche mit dem alten Menschen stellt der MDK fest, wie groß der
Bedarf an dauerhafter Beaufsichtigung und Betreuung ist oder ob
Maßnahmen der Prävention, Rehabilitation sowie Krankenbehandlung
durchgeführt werden können, um die Pflegebedürftigkeit zu vermindern.
Die Pflegekassen sind verpflichtet, spätestens fünf Wochen nach einem
Patienten-Termin des MDK zu entscheiden, für welche Pflegestufe der
jeweilige Patient ein Anrecht auf Zahlung einer Unterstützung hat.
Gestaffelt nach dem Grad der Pflegebedürftigkeit wird unterschieden
zwischen der Pflegestufe I (erheblich Pflegebedürftige), Pflegestufe II
(Schwerpflegebedürftige) sowie Pflegestufe III
(Schwerstpflegebedürftige) mit einer entsprechend gestaffelten Höhe der
finanziellen Leistungen. Bei diesen Leistungen unterscheiden die
Pflegekassen zwischen dem Pflegegeld, den Pflegesachleistungen und den
Leistungen für die teil- oder vollstationäre Pflege. Pflegegeld ist eine
Unterstützung, wenn Grundpflege und häusliche Versorgung in der eigenen
Wohnung, insbesondere durch Angehörige, erfolgen können.
Pflegesachleistungen sind eine Hilfe bei der Deckung von Kosten für
einen ambulanten Pflegedienst, und die höchsten Pflegesätze werden
gezahlt, wenn keine häusliche oder teilstationäre Pflege mehr möglich
ist. Im stationären Bereich sind Pflege, medizinische Behandlungspflege
sowie auch die soziale Betreuung mit den monatlichen Beträgen
abgesichert.
Personal wird im Schnitt jünger
Von
den insgesamt 2,63 Millionen Pflegebedürftigen wurden im Jahr 2013
764.000 Menschen in Pflegeheimen stationär betreut. Der Anstieg lag hier
bei 4,4 Prozent. Damit versorgte ein Pflegeheim im Schnitt rund 60
Personen, wobei sich Unterschiede zwischen privaten sowie gemeinnützig
bzw. öffentlichen Einrichtungen zeigten: Die privaten Träger betreiben
eher die kleineren Einrichtungen. Die Situation beim Pflegepersonal
zeigt in stationären Einrichtungen eine ähnliche Entwicklung wie in der
privaten oder ambulanten Pflege – der überwiegende Teil der hier
beschäftigten Personen ist weiblich (85 Prozent). 2013 waren in den
Pflegeheimen 685.000 Pflegerinnen und Pfleger in Teilzeit (62 Prozent)
und Vollzeit (31 Prozent) beschäftigt, was umgerechnet einem
Vollzeitäquivalent von 491.000 Stellen entspricht. Auszubildende und
(Um-)Schüler/-innen kamen hier mit sieben Prozent stärker zum Einsatz
als in der ambulanten Pflege, und sie machen, zusammen mit einer
wachsenden Zahl an Praktikantinnen und Praktikanten, mit 38,4 Prozent
einen immer größeren Teil der Belegschaften aus. Vor dem Hintergrund,
dass in der gleichen Zeit die Zahl der Vollzeitkräfte um 4,1 Prozent
sank und die Quote der Teilzeitbeschäftigten um 4,7 Prozent anstieg,
zeigt sich eine deutliche Verjüngung und Flexibilisierung der
Arbeitsverhältnisse. Eine Entwicklung, deren Verlauf künftig zu
beobachten sein wird, denn erstmals wurden mit der Pflegestatistik 2013
auch Daten zur Altersstruktur der Beschäftigten erhoben. Es zeigte sich,
dass rund ein Fünftel (19 Prozent) der Belegschaften unter 30 Jahre alt
waren, 43 Prozent zwischen 30 und 49 Jahre und immerhin noch mehr als
ein Drittel (38 Prozent) waren derzeit 50 Jahre oder älter.
Neues Pflegestärkungsgesetz
Bei
den Kosten für einen vollstationären Dauerpflegeplatz in der höchsten
Pflegestufe III ergab sich 2013 ein durchschnittlicher Tagessatz von 78
Euro für die Pflege sowie noch einmal 21 Euro für die Unterbringung und
die Verpflegung in einem Pflegeheim. Auf den Monat hochgerechnet fallen
also regelmäßig Pflegekosten von rund 3.017 Euro an, die durch die oben
beschriebenen Entgelte nach dem Pflegestufenmodell selbst in der
höchsten Stufe nicht gänzlich gedeckt sind. Es sind also private
Zuzahlungen der Seniorinnen und Senioren oder ihrer Angehöriger
erforderlich, um einen behüteten Lebensabend in einer Pflegeeinrichtung
verbringen zu können. Zumal natürlich unklar ist, wie sich die Kosten im
Pflegesektor künftig entwickeln werden. Mit dem Zweiten
Pflegestärkungsgesetz beschloss der Deutsche Bundestag im Dezember 2015
erst einmal die künftige Neuregelung des Begriffs der
Pflegebedürftigkeit und eine Änderung des Begutachtungsverfahrens durch
den MDK ab Januar 2017. Prof. Dr. h.c. Herbert Rebscher,
Vorstandsvorsitzender der DAK-Gesundheit: „Diese Reform ist nach 20
Jahren sozialer Pflegeversicherung ein zwar längst überfälliger, aber
herausragender Schritt zur Verbesserung der Versorgung. Die komplett
neue Definition der Pflegebedürftigkeit bedeutet einen enormen
Fortschritt. Endlich wird die soziale und psychische Situation der
pflegebedürftigen Menschen in gleicher Weise wie ihre körperlichen
Gebrechen bei der Begutachtung berücksichtigt.“
Emrich Welsing I redaktion@niederrhein-manager.de
Teilen: