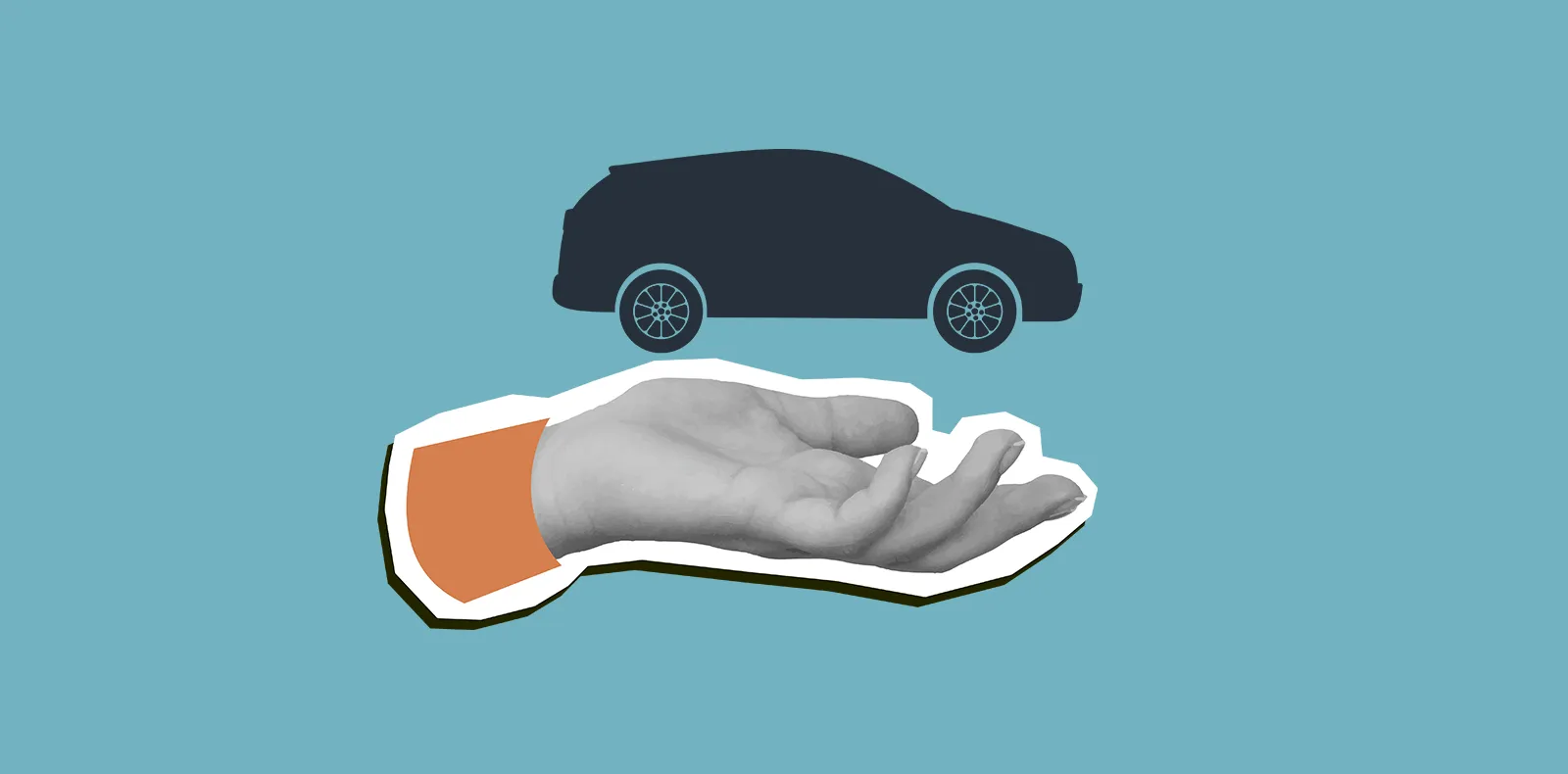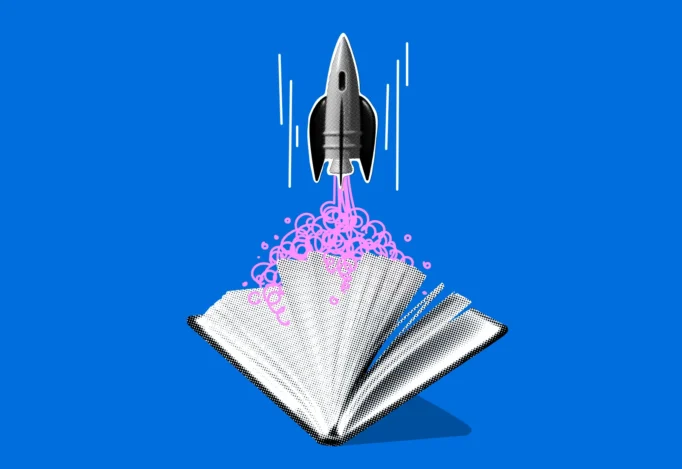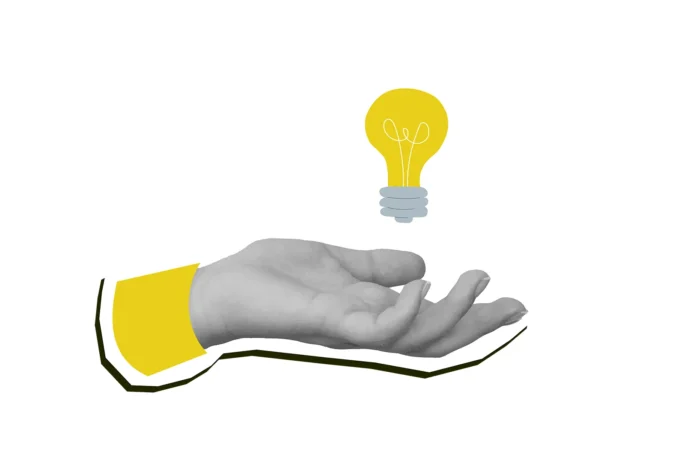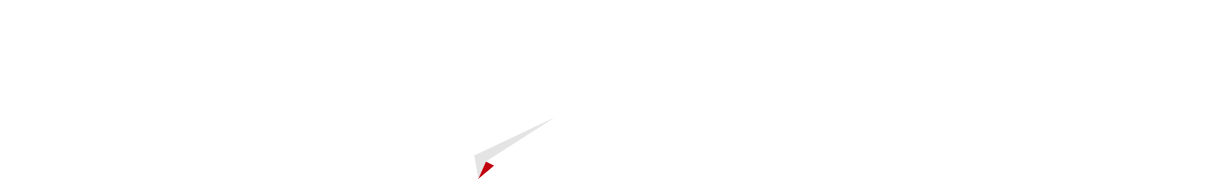KONJUNKTUR
Auto-Industrie weiter im Tief
Die für die Gesamtwirtschaft so wichtige deutsche Automobilindustrie kommt noch nicht aus ihrem lang anhaltenden Stimmungstief. Das zeigt die aktuelle ifo-Konjunkturumfrage. Der Index für das Geschäftsklima der Autoindustrie fiel im Juni zum dritten Mal in Folge leicht. Er erreichte -32,2 Punkte, nach -31,7 Punkten (saisonbereinigt) im Mai. „Die unsichere Situation im Welthandel trifft auf ohnehin schon verschärfte Bedingungen auf den weltweiten Absatzmärkten“, sagt ifo Branchenexpertin Anita Wölfl. „Für Optimismus sind die Signale aus dem Ausland noch zu unklar.“ Die Unternehmen bewerteten ihre aktuelle Geschäftslage im Juni schlechter, der Wert fiel auf -36,4 Punkte, nach -35,1 Punkten im Mai. Die Geschäftserwartungen sind von -28,3 Punkten im Mai leicht auf -27,8 Punkte im Juni gestiegen. Generell bewerteten die Unternehmen ihren Auftragsbestand deutlich besser als im Vormonat, wenngleich immer noch im negativen Bereich. Bei den Exporterwartungen setzt sich aber das Auf und Ab der vergangenen Monate fort. Der Indikator fiel auf -13,7 Punkte, nach -2,0 Punkten im Mai.
Dramatische Insolvenz-Zahlen
Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen ist im 1. Halbjahr 2025 auf den höchsten Stand seit zehn Jahren gestiegen. Nach Angaben der Creditreform Wirtschaftsforschung wurden 11.900 Unternehmensinsolvenzen registriert. Das entspricht einem Anstieg von 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum (1. Halbjahr 2024: 10.880 Fälle). Bereits im Vorjahr war ein kräftiger Zuwachs von 28,5 Prozent zu verzeichnen. „Trotz einiger Hoffnungssignale steckt Deutschland weiter in einer tiefgreifenden Wirtschafts- und Strukturkrise. Unternehmen kämpfen mit schwacher Nachfrage, steigenden Kosten und anhaltender Unsicherheit. Besonders die finanziellen Reserven schwinden, Kredite werden teils nicht mehr verlängert und immer mehr Betriebe geraten in ernsthafte Schwierigkeiten“, erklärt Patrik-Ludwig Hantzsch, Leiter der Creditreform Wirtschaftsforschung. Da auch im weiteren Jahresverlauf keine nennenswerte Konjunkturerholung erwartet wird, bleibt das Insolvenzrisiko derzeit hoch. „Die Zahl der Pleiten wird bis Jahresende weiter steigen“, prognostiziert Hantzsch. Auch bei den Privatpersonen setzt sich der Negativtrend fort: Im 1. Halbjahr 2025 wurden rund 37.700 Verbraucherinsolvenzen gemeldet – ein Plus von 6,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr (35.380 Fälle). „Das anhaltend hohe Insolvenzgeschehen löst zunehmend Kettenreaktionen aus. Seit drei Jahren steigen die Fallzahlen bei Privatpersonen kontinuierlich. Die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten sowie Arbeitsplatzverluste, insbesondere in der Industrie, setzen viele Haushalte massiv unter Druck“, so Hantzsch weiter.
Spuren der Trump-Politik
Die aggressive US-Handelspolitik unter Präsident Donald Trump hinterlässt tiefe Spuren: Deutsche Unternehmen in den Vereinigten Staaten blicken deutlich pessimistischer in die Zukunft. Das zeigt die aktuelle Sonderauswertung des AHK World Business Outlook (WBO) der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK). Grundlage ist eine weltweite Befragung der deutschen Auslandshandelskammern (AHKs), an der sich im Frühjahr 2025 über 4.600 Unternehmen beteiligt haben – darunter mehr als 100 mit Standorten in den USA. Die Erhebung fand zwischen Mitte März und Mitte April statt – also inmitten einer Phase wachsender handelspolitischer Turbulenzen zwischen den USA und ihren Partnern. „Was wir derzeit beobachten, ist eine regelrechte Zick-Zack-Politik der US-Regierung. Das schürt Unsicherheit, hemmt Investitionen und verunsichert selbst langjährig etablierte Unternehmen“, sagt DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier im Juni. Nur noch 14 Prozent der befragten deutschen Unternehmen in den USA rechnen mit einer konjunkturellen Verbesserung in den kommenden zwölf Monaten – im Herbst 2024 lag dieser Wert noch bei 38 Prozent. Gleichzeitig gehen 44 Prozent der Unternehmen aktuell von einer wirtschaftlichen Verschlechterung aus – eine Versechsfachung im Vergleich zur letzten Erhebung (7 Prozent). Das Bild hat sich um 180 Grad gewendet. Wo zuvor noch Hoffnung überwog, herrscht jetzt Ernüchterung. Auch bei den Geschäftserwartungen zeigt sich der Abwärtstrend: Nur noch ein Drittel der Betriebe rechnet mit einer positiven Geschäftsentwicklung, während rund ein Viertel mit einer Verschlechterung rechnet.
STARTUPS & UNTERNEHMERGEIST
Ungenutztes Gründer-Potenzial
Die Mehrheit deutscher Studierender wünscht sich schon in der Schule mehr Entrepreneurship. So bleibt ein Potenzial von jährlich bis zu 18.000 Neugründungen ungenutzt. Das sind zentrale Ergebnisse des Student Entrepreneurship Monitor 2025, veröffentlicht vom Startup-Verband. Die Studie beleuchtet das Gründungspotenzial unter Studierenden in Deutschland und zeigt: Die nächste Gründer-Generation steht in den Startlöchern. Jeder fünfte Studierende kann sich vorstellen, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Aktuell werden pro Jahr etwa 3.000 Startups gegründet. Wie wichtig die frühzeitige Sensibilisierung für das Thema ist, betont Dr. Kati Ernst, stellvertretende Vorstandsvorsitzende beim Startup-Verband: „Im Studium stellt man sich die Frage, wohin es geht und wie die eigene Karriere aussehen kann. Daher ist es so wichtig, genau hier die Unternehmensgründung als Option ins Spiel zu bringen und jungen Menschen gleich die nötigen Skills mitzugeben. Wenn wir dieses Thema ernst nehmen, kann daraus eine neue Ära der Innovation entstehen.“
PERSONAL & AUSBILDUNG
Große „Stille Reserve“
Im Jahr 2024 wünschten sich in Deutschland insgesamt knapp 3,1 Millionen Nichterwerbspersonen im Alter von 15 bis 74 Jahren Arbeit. Diese sogenannte Stille Reserve umfasst Personen ohne Arbeit, die zwar kurzfristig nicht für den Arbeitsmarkt verfügbar sind und momentan nicht aktiv nach Arbeit suchen, sich aber trotzdem Arbeit wünschen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) auf der Grundlage des Mikrozensus mitteilt, zählten insgesamt 4,6 Millionen Menschen zum ungenutzten Arbeitskräftepotenzial, das sich aus 3,1 Millionen Personen in Stiller Reserve und knapp 1,5 Millionen Erwerbslosen zusammensetzt. Diese „Stille Reserve“ lässt sich in drei Kategorien einteilen: Zur ersten Kategorie gehören Personen, die zwar Arbeit suchen, jedoch zum Beispiel aufgrund von Betreuungspflichten kurzfristig (innerhalb von zwei Wochen) keine Arbeit aufnehmen können. Personen der zweiten Kategorie würden gerne arbeiten und wären auch kurzfristig verfügbar, suchen aber aktuell keine Arbeit, weil sie zum Beispiel glauben, keine passende Tätigkeit finden zu können. Die dritte Kategorie umfasst Nichterwerbspersonen, die zwar weder eine Arbeit suchen noch kurzfristig verfügbar sind, aber dennoch einen generellen Arbeitswunsch äußern.
Ausländische IT-Kräfte gefragt
Rund 1,52 Millionen Fachkräfte waren im vergangenen Jahr in Deutschland in Berufen der Informatik, Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) tätig – ein Zuwachs von 4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Zuwachs ist laut Bundesagentur für Arbeit vor allem auf die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zurückzuführen, die seit 2014 um 70 Prozent (plus 463.000 Personen) anstieg. Dabei haben ausländische Fachkräfte einen relevanten Anteil am Wachstum: 2024 hatten 165.000 IKT-Fachkräfte keine deutsche Staatsangehörigkeit. Das sind 15 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in IKT-Berufen. Im Vergleich zu 2014 (45.000 Personen) hat sich die Zahl von ausländischen Beschäftigten hier gut verdreifacht. Der größte Zuwachs war bei Beschäftigten aus Indien, den acht zugangsstärksten Asyl-Herkunftsländern, Russland, der Türkei und der Ukraine zu verzeichnen. Unter den ausländischen IKT-Fachkräften hatten 2024 insgesamt rund 15.000 die Staatsangehörigkeit eines der zugangsstärksten Herkunftsländer von Asylbewerberinnen und Asylbewerbern. Der Großteil kam aus dem Iran (5.000), Pakistan (4.000) und Syrien (3.000). Während die Beschäftigungszahlen steigen, ist zur Zeit jedoch ein Rückgang der gemeldeten Stellen zu verzeichnen. Dieser Trend resultiert aus der aktuellen wirtschaftlichen Schwäche und einem branchenspezifischen Strukturwandel.
DIGITALES UND DATENSCHUTZ
Nicht im Flugmodus
„Herzlich willkommen an Bord unseres Fluges. Wir bitten Sie nun, Ihre Plätze einzunehmen und die Sicherheitsgurte zu schließen. Bitte stellen Sie sicher, dass alle elektronischen Geräte entweder ausgeschaltet oder in den Flugmodus versetzt sind.“ Eine solche Durchsage dürfte den allermeisten, die schon einmal an Bord eines Flugzeuges waren, bekannt vorkommen. Eine Umfrage zeigt nun aber, dass nicht alle dieser Bitte auch immer nachkommen: 42 Prozent der deutschen Flugreisenden geben zu, während eines Fluges schon einmal heimlich ein technisches Gerät ohne Flugmodus verwendet zu haben. Unter den jüngeren Flugreisenden zwischen 16 bis 29 Jahren sind es mit 54 Prozent sogar mehr als die Hälfte, während sich in der Generation ab 65 Jahren mit 18 Prozent die meisten an die Vorgaben halten. Das sind Ergebnisse einer repräsentativen Befragung unter 1.006 Personen ab 16 Jahren, darunter 835 Personen, die schon einmal geflogen sind. „Der Flugmodus soll verhindern, dass elektronische Geräte die Bordtechnik und den Funkverkehr stören“, erklärt Dr. Sebastian Klöß, Experte für Consumer Technology beim Branchenverband Bitkom. „Inzwischen erlauben einige Airlines aber die Nutzung von WLAN oder Bluetooth während des Fluges, weil moderne Systeme besser abgeschirmt sind. Trotzdem bleibt der Flugmodus besonders zu Beginn und am Ende des Fluges eine Sicherheitsvorkehrung, die nicht leichtfertig ignoriert werden sollte.“ Für viele sollte dies auch kein allzu großes Problem sein, denn sie sorgen für die Offline-Zeit im Flieger vor: Fast ein Drittel (31 Prozent) lädt sich in der Regel vor einem Flug Musik oder Filme herunter. Auch das ist unter den Jüngeren mit 47 Prozent wesentlich verbreiteter als bei den Älteren (15 Prozent).
ENERGIE & MOBILITÄT
Eine große Verbändeinitiative aus der Energiewirtschaft und aus der Industrie ruft die Bundesregierung dazu auf, eine Wasserstoff-Allianz auf EU-Ebene zu initiieren. Auf diese Weise könne die Vereinbarung im Koalitionsvertrag, eine führende Rolle in einer europäischen Wasserstoffinitiative einzunehmen, mit Leben gefüllt und der Hochlauf der europäischen Wasserstoffwirtschaft erfolgreicher vorangetrieben werden. Wasserstoff und seine Derivate sind nach Ansicht der Initiatoren unverzichtbar, um Klimaneutralität zu erreichen, Versorgungssicherheit zu gewährleisten und den Industriestandort in Deutschland langfristig zu sichern. Der Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft berge zudem enormes Potenzial für die Wettbewerbsfähigkeit der EU, ihre globale Innovationskraft und Technologieführerschaft sowie zur Stärkung der Resilienz. Doch der Hochlauf werde aktuell politisch erschwert: „Angesichts komplexer und unklarer regulatorischer Vorgaben, die zudem zu zusätzlicher Verteuerung führen, Verspätungen bei Infrastrukturprojekten und der dadurch noch zögerlichen Nachfrage, ist eine zunehmende Verunsicherung zu beobachten. Hier muss dringend gegengesteuert werden“, heißt es vom BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, der zusammen mit vielen weiteren Akteuren (unter anderem Deutsche Verein des Gas- und Wasserfaches, Deutscher Wasserstoff-Verband, Verband der Chemischen Industrie und Wirtschaftsvereinigung Stahl) den Aufruf gestartet hat.
Teilen: