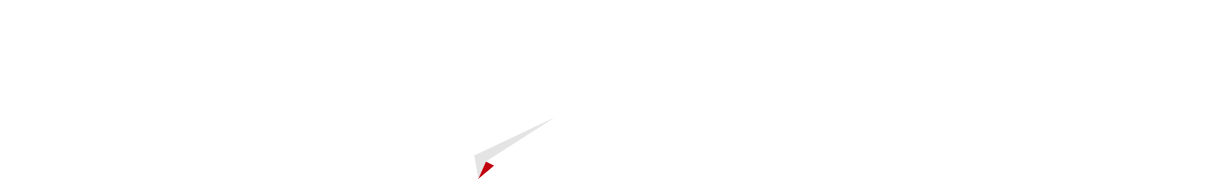Der energetische Zustand einer Immobilie spielt eine immer wichtigere Rolle für deren Wertentwicklung, aber auch die Vermarktbarkeit auf dem Mietmarkt. In der teils aufgeheizten, teils sehr unübersichtlichen Materie schwirren viele Begriffe umher – allen voran „Energieausweis“ und „Wärmeschutznachweis“. Erfahren Sie hier, was dahintersteckt, welche Gemeinsamkeiten es gibt, aber vor allem welche fundamentalen Unterschiede.
Das ewige Mantra gilt nicht mehr – oder zumindest bei Weitem nicht mehr so uneingeschränkt wie früher. „Lage, Lage, Lage“ war über Generationen von Immobilieneigentümern das zentrale Argument für den Kauf einer Immobilie zur Eigenanlage und noch mehr als Kapitalanlage. Doch das hat sich mit den immer stärker spürbaren Folgen des Klimawandels und den steigenden Kosten vor allem für Öl, Gas und konventionell erzeugten Strom dramatisch geändert. „Der energetische Zustand einer Immobilie – ob Neubau oder Bestandsgebäude – und deren Energieeffizienz spielen für die langfristige Wertentwicklung heute und künftig eine zentrale Rolle“, sagt der Immobiliengutachter und Energieberater André Heid.
Wärmeschutznachweis und Energieausweis: ähnliches Thema, aber viele Unterschiede im Detail
Immobilienbesitzer müssen sich diesem Thema stellen – und stoßen dabei häufig gefühlt auf eine Wand an neuen Verordnungen und Begriffen. Dabei spielen zwei Vokabeln eine besondere Rolle: der „Energieausweis“ und der „Wärmeschutznachweis“. Häufig werden die beiden Dokumente aus Unwissenheit miteinander gleichgesetzt. Dabei haben sie in der Praxis, in ihrer Ausgestaltung und Detailtiefe sehr unterschiedliche Aufgaben.
Der Wärmeschutznachweis spielt seit Inkrafttreten des „Gebäudeenergiegesetzes“ (GEG) eine wichtige Rolle und wird oft auch als „GEG-Nachweis“ oder „EnEV-Nachweis“ bezeichnet. Es handelt sich dabei um ein zentrales Dokument für alle Neubauten in Deutschland. André Heid: „Der Wärmeschutznachweis ist ein detaillierter Nachweis, der während der Planungs- und Bauphase erstellt wird, um zu belegen, dass ein Neubau die gesetzlichen energetischen Anforderungen erfüllt.“
Das Dokument gehört zwingend zur Bauvorlage oder anders formuliert: Ohne Wärmeschutznachweis gibt es kein grünes Licht von der örtlichen Baubehörde – und die Bagger und Zementmischer für den Neubau eines Ein- oder Mehrfamilienhauses dürfen nicht losrollen.
Der Energieausweis ist dagegen der wesentlich kleinere Bruder des Wärmeschutznachweises und eine Art Steckbrief für fertiggestellte Gebäude. Seine Aufgabe: Er fasst den energetischen Zustand des Hauses zusammen und bewertet vor allem den Energiebedarf und Energieverbraucht. Der Energieausweis muss Mietinteressenten oder potenziellen Käufern einer Eigentumswohnung oder eines Hauses aktiv vorgelegt werden; die Pflicht besteht unabhängig von deren Wunsch. (§ 80 GEG)
Das steht im Energieausweis
Energieausweise enthalten allgemeine Angaben zum Haus, zu den verwendeten Energieträgern wie Gas, Holzpellets oder Strom sowie die Energiekennwerte des Gebäudes. Neuere Ausweise für Wohngebäude führen darüber hinauseine Energieeffizienzklasse von A+ bis H auf – das ist vergleichbar mit den Farbcodes für Elektrogeräten wie Fernsehern, Kühlschränken oder Waschmaschinen. Bei einem Wohngebäude wird ein Energieausweis für das ganze Gebäude ausgestellt, nicht für eine einzelne Wohnung. In Gebäuden, in denen es sowohl Wohnungen als auch anders genutzte Räume gibt, gilt der Energieausweis nur für den Wohnbereich.
„Im Gegensatz zum Energieausweis, der für Bestandsgebäude und Neubauten gleichermaßen erforderlich ist, dient der Wärmeschutznachweis ausschließlich dem Nachweis, dass ein Neubau die aktuellen energetischen Vorgaben erfüllt“, stellt André Heid nochmals den zentralen Unterschied heraus. Ein Wärmeschutznachweis für den Neubau gehört zu den obligatorisch einzureichenden Bauvorlagen. Entscheidend für die Aussagekraft des Nachweises ist dabei, dass die Berechnung Hand und Fuß hat – und die Energieberater etwas von ihrem Fach verstehen. Ein Energieberater sollte nach DIN V 18599 und GEG zertifiziert sein, den aktuellen Energieverbrauch analysieren, Effizienzkonzepte entwickeln und auf Wunsch auch bei der Beantragung von Fördermitteln unterstützen.
So gibt es bei staatlichen Institutionen wie der Förderbank KfW oder dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) mit Sitz in Eschborn bei Frankfurt am Main zahlreiche Förderprogramme für energetische Sanierungen. Auch die Inanspruchnahme von Energieberatern ist förderfähig – bei Wohngebäuden im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), bei Nichtwohngebäuden im Rahmen der Energieberatung nach DIN 18599.
Wärmeschutznachweis: Warum sich die Pflicht zu Beginn später als kostensenkende Kür erweist
Ein Energieausweis kostet für ein Wohngebäude zwischen 400 und 700 Euro. Der Wärmeschutznachweis ist meist aufwendiger, da er eine detaillierte Berechnung und Nachweisdokumentation erfordert. Er kostet in etwa das Doppelte bei einem Einfamilienhaus – für ein Mehrfamilienhaus oder bei Gewerbebauten mit entsprechend komplexeren Berechnungen sind die Kosten nochmals höher. „Doch abgesehen davon, dass Wärmeschutznachweise für Neubauten Pflicht sind: Sie rechnen sich auch. Denn wer vor Baubeginn viel Zeit und etwas mehrt Geld für eine optimale Wärme- und Energieplanung beiseitelegt, wird über die Jahre mit deutlich geringeren Ausgaben für Wärme, Kühlung oder Strom belohnt“, sagt Experte Heid.
Teilen: