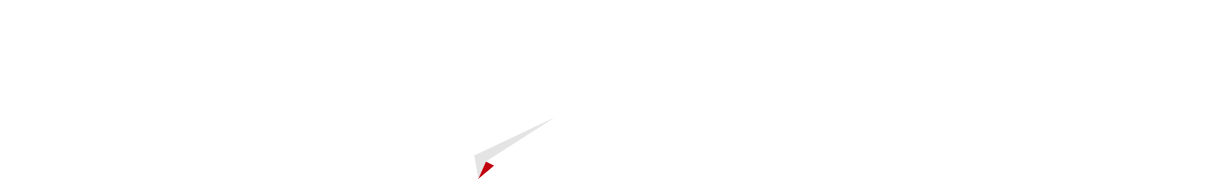Wer gescheitert ist und wie ein Boxer trotzdem immer wieder aufsteht, den mögen die Amerikaner. Der deutsche Investor Lars Windhorst ist im Grunde so einer, der in Amerika ankommt. Seinen Weg pflastern seit Jahren Pleiten und Skandale, aber unverdrossen zieht er ein neues Projekt nach dem anderen an Land. Sein Image in Deutschland ist, nun ja, halbseiden.
Scheinheilige Chefs
Aber hier ändert sich gerade etwas, denn natürlich weiß man auch bei uns, dass ungezählte Innovationen zufällig aus Fehlern entstanden sind: wie Tesafilm, Dynamit, auch Viagra. Scheitern als Chance. Auf „Fuckup Nights“ wird seit einigen Jahren freimütig über berufliche Fehlschläge gesprochen. Die ZDF-Doku „The Finest Fckup“ zelebrierte kürzlich unternehmerische Bruchlandungen. Eine offene Fehlerkultur könnte dabei helfen, einen falschen Kurs im Unternehmen frühzeitig zu erkennen und zu korrigieren – noch vor dem Scheitern. Eine Überzeugung, die sich offenbar durchsetzt: Nach dem „Fehlerkultur Report 2023“ (EY, ESCP Business School und Hochschule Hamm-Lippstadt) sind Führungskräfte und Angestellte vom großen Wert einer positiven Fehlerkultur in den Unternehmen überzeugt. Aber hier tut sich eine Schere zwischen Anspruch und eigenem Verhalten auf. Nach dieser Studie gaben 64 Prozent der befragten Führungskräfte eigene Fehler gar nicht oder nur teilweise zu. In der Finanzbranche kehrten sogar 82 Prozent der Führungskräfte ihre Fehlschläge ganz oder teilweise unter den Teppich. Es verwundert nicht, dass Deutschland im Ranking der Fehlertoleranz weltweit den vorletzten Platz unter 61 Nationen einnimmt. Eine positive Fehlerkultur bedeutet dagegen, Fehler proaktiv und konstruktiv zu managen statt sie zu verschweigen oder zu sanktionieren – und zwar in einem Top-Down-Prozess.
Rasanter Start
In Düsseldorf-Pempelfort eröffnete im Herbst 2024 das Restaurant Taco Craze, das nur kurze Zeit später auf der Messe Internorga den Gastro-Gründerpreis für den „Mix aus mexikanischem Street Food und Gamification“ gewann. Doch dann im Mai 2025 die Insolvenz – ein Insolvenzverwalter ist bestellt, der Betrieb läuft derzeit weiter mit etwas weniger Personal. Niclas Janus, Gründer neben Quency de Leon Roa, berichtet offen über die Gründe: „Wir haben den Standort sogar mit Mobilfunkdaten analysiert. 260.000 Passanten im Monat sind sehr viel. Aber wir haben dabei übersehen, dass die uns nichts bringen, wenn sie an uns vorbeilaufen, um sich ihr Abendessen im Supermarkt zum Kochen zu Hause zu kaufen.“ Das zweite Learning: „Wir haben auf die harte Tour lernen müssen, dass ein traditionelles Geschäft wie Gastronomie nicht unbedingt mit dem amerikanischen Konzept des Blitzscalings zu vereinen ist – zumindest nicht in Deutschland. Manchmal geht doch nichts über die ‚alte Schule‘.“ Weitere Faktoren: Social Media sorgten für einen rasanten Start, dann kam eine flauere Periode; der Einkauf lief nicht optimal; die Anzahl der Sitzplätze reichte nicht aus; gleichwohl musste anfangs noch eine Küche hinzugemietet werden – Verbindlichkeiten zusammen mit der nun anstehenden Steuerzahlung im April führten zur Malaise.
Schnelle Insolvenz
Die Gründer sprachen offen über den Misserfolg. „Ich erhielt von einigen vornehmlich älteren Kollegen komische Anrufe. Aber ich habe doppelt so viele Anrufe und Nachrichten bekommen von Leuten, die es sehr mutig finden, darüber zu sprechen und dass das auch immer mehr Leute tun sollen“, so Janus. „Insgesamt war das Feedback deutlich positiver, als zu erwarten gewesen wäre. Wir haben dadurch einige Kontakte bekommen, die auch für jetzt gerade immer noch potenziell über Investments mit uns verhandeln. Schon in der Gründungsphase gingen wir davon aus: Mit je mehr Menschen wir darüber sprechen, desto mehr Informationen bekommen wir, die tendenziell helfen können.“ Die Laune der Gründer ist nach der emotionalen Achterbahnfahrt immer noch gut. Was sie beim nächsten Mal anders machen würden? „Wir würden uns mehr Zeit nehmen für einen guten Standort und wir gründen nur, wenn die Bedingungen zu 95 Prozent erfüllt sind und nicht nur zu 80 Prozent.
Geschäftsidee belächelt
Isabelle Forster hat in Köln eine Bäckerei mit süßen Gemüsekuchen aufgemacht. Sie liebt Kuchen, aber mit traditionellen Zutaten verträgt sie ihn nicht mehr. Ihre veganen und glutenfreien Snack-Kuchen „Better Cakez“ mit bis zu 34 Prozent Gemüseanteil sind „to go“, kommen ohne raffinierten Zucker, künstliche Konservierungsstoffe oder Palmöl aus und sind ein Jahr lang haltbar. Nach ihrem Jura-Staatsexamen hatte sie nach gravierenden, ernährungsbedingten Gesundheitsproblemen mit „Better Cakez“ losgelegt. Aber im Umfeld ihrer Kommilitonen und ihres Vaters – Unternehmer und Zahlenmensch – wurde sie belächelt. Das hätte sie anfangs fast zum Aufgeben gebracht. Ihr Vater konnte sich nicht vorstellen, dass man damit Geld verdienen kann, wie auch ihr sonstiges Umfeld, überwiegend Juristen. Man machte sich lustig über das Branding in pink und rosa. „Es ist zwar ein weibliches Klischee, aber ich dachte mir immer: Pink und rosa und Kuchen passen perfekt zusammen.“ Es waren also psychologische Faktoren, die ihr Unternehmen fast schon vor der Gründung zum Scheitern gebracht hätten. „Ganz am Anfang hat die Kritik mir schlaflose Nächte beschert, auch weil ich mit Jura ein gutes Einkommen garantiert hätte und mein Studium eigentlich ein bisschen umsonst gewesen wäre“. Isabelle Forster biss sich dann durch, bis die ersten positiven Stimmen kamen. Heute beschäftigt sie in ihrer Bäckerei 16 Mitarbeiter. Better Cakez sind bisher nur online erhältlich, aber Gespräche über den Eintritt in den Einzelhandel laufen. Isabelles Unternehmen erreicht Millionen Menschen auf Social Media und sie ist Gewinnerin des „Macherinnen“-Award.
Dr. Marie-Christine Frank, Gründerin des Netzwerks „Macherinnen“ und der Kommunikationsagentur „Drei Brueder“ in Köln, hat den Preis ins Leben gerufen. Sie sieht in der Herangehensweise vieler Frauen im Berufsleben eine besondere Stärke: „Ich habe den Eindruck, dass Frauen untereinander offener mit Fehlern umgehen und eher bereit sind, ihre Erfahrungen zu teilen. Zudem zeigen sie häufig viel Offenheit für Ratschläge – oft in der Hoffnung, daraus konkrete Unterstützung zu gewinnen. Das kann dazu beitragen, den Kurs bei Bedarf schneller zu korrigieren.“
Erfahrung willkommen
Im Venture Capital-Geschäft zielt jedes Investment darauf ab, die Möglichkeit eines erfolgreichen Unternehmensaufbaus von Anfang an zu maximieren – so auch bei der NRW.BANK. „Ich nenne das ein Management der Chancen“, erklärt Venture-Kapital-Chef Dr. Claas Heise. „Wir schauen ganz genau, welches Geschäftsmodell gut skalierbar und erfolgversprechend ist. Denn letztendlich geht es darum, dass das Unternehmen die Chance hat, einen erfolgreichen Exit zu realisieren. Erst dann wird das Investment realisiert. Im Venture Capital-Geschäft führen von etwa 100 Anfragen höchstens ein bis zwei zu Investments. Zurückhaltend sind wir beispielsweise bei Geschäftsmodellen, die viel Geld verschlingen, aber keine neue Technologie entwickeln.“ In den Gesprächen im Vorfeld eines möglichen VC-Investments wird auch immer nach vorheriger unternehmerischer Erfahrung gefragt. „In der Due Diligence ist die Erfahrung des Management-Teams – das kann auch die Erfahrung unternehmerischen Scheiterns sein – ein wesentliches Kriterium.“ Generell lässt sich sagen: Neun von zehn Startups scheitern und die durchschnittliche Lebensdauer eines Geschäftsmodells ist von 15 auf weniger als fünf Jahre gesunken. Mit einer aktiven Fehlerkultur lässt sich der Schiffbruch vielleicht im Einzelfall noch verhindern.
Teilen: